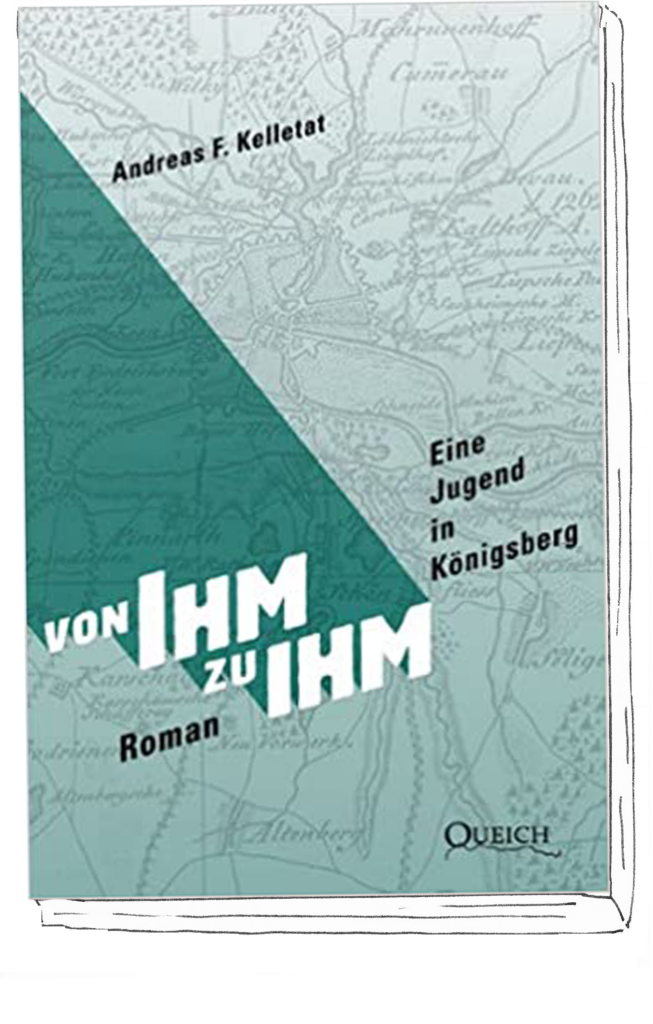Vortrag auf der von Sabine Baumann moderierten VdÜ-Veranstaltung Die Zeitschrift Übersetzen feiert (2. Oktober 2021, Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg)
Im Titel meines Vortrags kommt das Wort „Translation“ bzw. „translationshistorische Forschung“ vor. Es soll signalisieren: Ich schaue als Translationswissenschaftler, als Forscher ausdem Germersheimer Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, in das digitalisierte Archiv der VdÜ-Zeitschrift namens Der Übersetzer bzw. Übersetzen.
Eine Vorbemerkung daher: Das Fach Translationswissenschaft, auch „Translatologie“ genannt, hat sich in den späten 60er und 70er Jahren als eigene akademische Disziplin konstituiert. Und das geschah in den damals noch zwei Deutschländern an Ausbildungsstätten für angehende Fachübersetzer und Konferenzdolmetscher, also an den Universitäten Heidelberg, Leipzig, Saarbrücken oder halt in Germersheim.
Die 1946 von der französischen Besatzungsmacht gegründete Germersheimer Ausbildungsstätte für Übersetzer und Dolmetscher hieß von 1972 bis 1992 Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft. Der Name verrät, von welcher Wissenschaft man sich damals am ehesten die Lösung sämtlicher mit dem Übersetzen verbundener Probleme erwartete: von der Sprachwissenschaft bzw. der Linguistik chomskyscher Ausrichtung.
1971 berichtete Werner Koller in zwei Heften der VdÜ-Zeitschrift Der Übersetzer über die Anfänge der Übersetzungswissenschaft als Teilbereich der Linguistik. Koller stellte die neuesten Theorien zur „Modellierung des Translationsprozesses“ vor, bei der ein „Translator die Umkodierung (vollzieht); es kann sich um den Menschen oder die Maschine handeln. Das Translat schließlich ist das Produkt der Translation“ (Jg. 8, Nr.5, S.2).
Bei solchen Formulierungen mögen 1971 manchem Leser des VdÜ-Monatsheftes die Ohren gejuckt haben. Dass das Literaturübersetzen die neue Wissenschaft von der Translation eher nicht interessierte, hat Werner Koller allerdings auch bereits verraten. Denn es heißt bei ihm: „Die Übersetzung ist ein linguistisches Phänomen, mindestens was pragmatische Texte anbelangt – die literarische Übersetzung wird meistens als ‚Kunst‘ aus der linguistischen Theorie ausgeschlossen“ (ebd., S.1).
An dieser Ausschließeritis hat die Translatologie lange festgehalten. Mit dem literarischen Übersetzen hat sie sich nur selten in einer Weise befasst, die von Literaturübersetzern als Einladung zum Gespräch hätte angenommen werden können. 1984, im November/Dezember-Doppelheft, schreibt Rosemarie Tietze (damals mit Holger Fliessbach für die Redaktion verantwortlich):
Unter Übersetzern genießt die Wissenschaft vom Übersetzen keinen besonders guten Ruf. Denn leider kommt sie nicht selten auf derartigen Wortstelzen daher, daß jeden, der mit Sprache arbeitet, das schiere Grausen packt. Oder wir werden vom Katheder herab belehrt, wie wir zu übersetzen hätten. Da geht man lieber wieder an den Schreibtisch und tut es – unbelehrt.
(Jg. 21, H.11/12, S. 4)
Es ist schon auffällig: Die Translationswissenschaft konnte mit dem Literaturübersetzen nichts anfangen und die Literaturübersetzer nichts mit den Translatologen. Das änderte sich auch nicht, als ab Mitte der 80er Jahre die von Hans J. Vermeer erdachte, auch das Literaturübersetzen vereinnahmende Skopos-Theorie ihren antilinguistisch-antiphilologischen Siegeszug in den Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher begann. Gibt man das Wort „Skopos“ in das Suchfenster des digitalen Heft-Archivs ein, so erzielt man keinen einzigen Treffer. Und bei „Vermeer“ findet sich nur ein Treffer, im Juli-Dezember-Heft des Jahres 2020, aber da geht es um Jan Vermeer van Delft, den holländischen Maler aus dem 17. Jahrhundert.
Besser steht es um die Heidelberger Translatologin Christiane Nord. Die „Begründerin der deutschen Grundlagenforschung zum Problem der Titelübersetzung“ wird mit ihren an 12.500 Titeln gewonnenen Überlegungen zu eben jener Übersetzung von Buchtiteln ausführlich vorgestellt (Heft 1/2000).
Fragt man nach den Ursachen für die – nach Ausweis des Heft-Archivs – jahrzehntelange Sprachlosigkeit zwischen Translatologen und Literaturübersetzern, so wird man nicht nur auf den von Rosemarie Tietze beklagten wortstelzenartigen Sprachgebrauch der Translationswissenschaftler hinweisen müssen. Man sollte auch schauen, wo und für wen sie ihre Theoriegebäude errichtet haben: in Institutionen, in denen junge Leute zu künftigen Fachübersetzern ausgebildet werden. Und charakteristisch für diese Übersetzer ist, dass sie in aller Regel die von ihnen verfassten Translate nicht mit ihrem Namen signieren: Die Bedienungsanleitungen, Werbetexte, Internetseiten, Verträge, Protokolle, Gesetze, Behördentexte, EUDirektiven, Ansprachen usw. usf. Und wenn diese jungen Leute sich nach dem Studium als Fachtext-Translatoren auf dem Arbeitsmarkt etablieren wollen, so treten sie dem BDÜ bei, dem Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer mit seinen heute ca. 7.500 Mitgliedern.
Im Unterschied zu dieser Gruppe signieren Literaturübersetzer ihre Translate und sie organisieren sich (wenn sie es denn tun) im VdÜ, dem Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke mit seinen ca. 1250 Mitgliedern. Anders als die Verfasser nicht-signierter Texte sind Literaturübersetzer – so steht es in VdÜ-Mitteilungen – auch Urheber ihrer Übersetzungswerke und sie genießen wie die Autoren den Schutz des Urheberrechts. Wie sich der VdÜ um die konkrete Ausgestaltung dieses Rechtes durch Jahrzehnte mit wechselndem Erfolg bemüht hat – auch dafür finden sich im Heftarchiv Belege, Stichwort u.a.: „Mustervertrag“. Über ihn wird erstmals im Anschluss an den legendären internationalen Hamburger Übersetzer-Kongress von 1965 berichtet unter der Überschrift Rechte des Übersetzers (Jg.2, H.9, S.1-3).
Wie es zur Verteilung der Übersetzerzunft auf BDÜ und VdÜ gekommen ist, wäre ein eigenes Kapitel in der zu schreibenden Kulturgeschichte des Übersetzens. Das Heftarchiv gibt darüber keine klare Auskunft, muss es wohl auch nicht.
Dass es in der Zeitschrift des VdÜ immer auch um übersetzte Texte, aber stärker noch um jene gehen sollte, die diese Texte jeweils übersetzt haben, war schon am Namen erkennbar: Der Übersetzer hieß sie durch über 30 Jahre, von 1964 bis 1997. Mit dem Wechsel der Redaktion von Silvia Morawetz zu Kathrin Razum änderte sich der Titel der Zeitschrift. Aus Der Übersetzer wurde Übersetzen.
Ging es der Redaktion des Übersetzers 1997 also darum, den Prozess des ÜbersetzENS statt die Person des ÜbersetzERS stärker in den Fokus zu rücken? Kann man in der Änderung des Titels womöglich eine ungewollte Bestätigung der fast zeitgleich geprägten These des amerikanischen Translatologen Lawrence Venuti erkennen? The Translator’s Invisibility heißt sein 1995 erschienenes Buch. In dem Artikel Die kulturwissenschaftliche Wende in der Übersetzungsforschung wird es in einem Übersetzen-Heft erwähnt, jedoch erst 2006.
Die Umbenennung der Zeitschrift zielte natürlich nicht auf die invisibility ihrer gesamten Hauptleserschaft. Es ging 1997 um das Genderproblem, also darum, dass manche aus dieser Leserschaft als Mitgliederinnen sichtbar gemacht werden wollten. In einer Mitteilung der neuen Redaktion wird dann auch eifrig das große Binnen-I verwendet: „TeilnehmerInnen“, „KollegInnen“, „ÜbersetzerInnen“. Wie die Zeitschrift und der VdÜ im Lauf der Jahrzehnte generell mit dem „Gender-Trouble“ (Angela Plöger, H.2/2020) umgegangen sind, wäre eine eigene translationshistorische Miszelle wert.¹ 2019 (Heft 2) wurde – für mein Sprachgefühl ziemlich wortstelzenartig – mitgeteilt, dass nunmehr auch der VdÜ seinen Namen geändert habe,
sodass unser voller Titel jetzt lautet: Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. / Bundessparte Übersetzer/innen im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in ver.di. Kurz – wie immer – VdÜ.
(Jg. 53, H.2 / 2019)
Dass Der Übersetzer auch bei einem anderen Thema seiner Zeit verblüffend weit voraus war, zeigt mir ein Beitrag, in dem es um eine „schwarzamerikanische“ Autorin ging, die für ihre Texte auf einer „afrodeutschen Übersetzerin“ bestand. Denn „sie befürchtete, eine Weiße könnte ihr ‚Schwarzsein‘, ihre Empfindungen als Schwarze, ihre Probleme nicht vermitteln.“ Der Text im Übersetzer stammt nicht aus dem Black Lives Matter-Jahr 2020, es geht in ihm auch nicht um Amanda Gormans Inaugural-Poesie von 2021, sondern Margarete Längsfeld hat ihn 1987 veröffentlicht, als sie Essays von Audre Lorde ins Deutsche zu bringen hatte. (Jg. 23, H.7/8 1987).
***
Auf ein zentrales Charakteristikum der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Übersetzen möchte ich hinweisen: Wir finden durch Jahrzehnte zahllose von Linguisten, Literaturwissenschaftlern und Translatologen geschriebene Bücher und Aufsätze, in denen es um Übersetzungen geht, jedoch nur höchst selten um Übersetzer, um jene also, die all diese Übersetzungen geschrieben haben.
„Eine Übersetzung schreiben“ – Das würde im Schulaufsatz als grober Fehler, als unidiomatisch bzw. als Kollokationsverstoß rot angestrichen. Übersetzungen werden im Deutschen „angefertigt“, „gemacht“, „erstellt“, vielleicht sogar „erarbeitet“ – aber nie und nimmer „geschrieben“. „Geschrieben“ wird ausschließlich Eigenes: ein Brief, ein Aufsatz, ein Gedicht, ein Roman. Was ist da also bereits in unserer Sprache bis in die Nomen-Verb-Beziehung hinein 1 4 fest verankert? Es ist der Primat des Originals. Und es ist diese Fixierung auf das Original und seinen Schöpfer bzw. Urheber, der genau zeitgleich mit dem Aufkommen des Originalitätsund Urhebergedankens die Übersetzer in die Unsichtbarkeit gebracht hat, in die Invisibilität. Das ist indes ein historischer Prozess, der bereits zwei Jahrhunderte vor der Gründung des VdÜ begonnen hat.
Wie sich die determinativlose Autorzeile und analoge Verbannung des Übersetzernamens auf die Rückseite der Titelblätter oder sogar ins Nirgendwo in unseren übersetzten Büchern durchgesetzt hat und welche Auswirkungen (etwa in Bibliothekskatalogen) das für die Befestigung des Originalitätsdispositivs nach wie vor hat – diese wirkmächtige Text-PersonRelation wurde von Aleksey Tashinskiy 2016 in seinem Aufsatz Das Werk und sein Übersetzer ausführlich untersucht.
Im Heft 7/8 1987 stieß ich auf die Überschrift Der Übersetzer und sein Autor. Da wurde das gängige Begriffspaar „Der Autor und sein Übersetzer“ umgedreht. Diese Vertauschung der Beobachtungsposition ist Hauptkennzeichen unserer Arbeit am seit 2015 entstehenden, ebenfalls digital frei zugänglichen Germersheimer Übersetzerlexikon (uelex.de). Wobei wir noch einen Schritt weitergehen, indem wir nicht nur jeweils ein einzelnes Übersetzer-AutorPaar in den Blick nehmen, sondern wir fragen nach dem Übersetzer und seinen AutorEN – und das sind oft sehr viele.
Wir ordnen die Übersetzungen also nicht mehr den jeweiligen Ausgangsautoren zu, sondern wir wollen wissen und darstellen, was ein einzelner Übersetzer (aus oft verschiedenen Sprachen!) insgesamt ins Deutsche gebracht hat. So wie die Literaturwissenschaft nach dem Autor und seinem Werk fragt, so fragen wir als Translationshistoriker nach dem Übersetzer und seinem Werk, nach seinem „translatorischen Œuvre“. Die Text-Person-Relation wird geändert, wodurch sich unser Blick auf die Geschichte des Übersetzens grundlegend von all jenen Forschungsbeiträgen unterscheidet, die bisher von den Einzelphilologien, der Komparatistik oder auch der traditionellen Translatologie erbracht worden sind.
Wir fragen nach der Sprach- und Geobiographie eines Übersetzers: Wie und wo hat er die Sprachen erlernt, aus denen er übersetzt hat: Spielten dabei Schule und Studium, bikulturelle Ehe, freiwilliger oder erzwungener Aufenthalt in anderen Ländern eine Rolle? Und natürlich soll auch das WIE des Übersetzens charakterisiert werden, wofür als Quellen zeitgenössische Kritiken dienen, Laudationes, wissenschaftliche Beiträge und translationspoetologische Aussagen der Übersetzer selbst in Briefen, Interviews und Tagebüchern oder auch Werkstattprotokolle.
Für all diese Aspekte ist die VdÜ-Zeitschrift eine Fundgrube. Das beginnt mit der Prosopographie, also der Zusammenstellung einer Namensliste, wer in den letzten sieben Jahrzehnten als Literaturübersetzer in Erscheinung getreten ist. Aufschlussreich für einen ersten Einblick in das jeweilige translatorische Œuvre sind die in der Zeitschrift regelmäßig veröffentlichten Nachrufe. Wobei ich als Wissenschaftler natürlich beachten muss, dass diese Textsorte (ähnlich der Preisrede) stark hagiographisch ausgerichtet ist und nicht die Funktion hat, einen nüchtern-kritischen Blick auf das Leben und Werk eines Übersetzers zu richten. Dafür müsste man auch Zugang zu dem jeweiligen Übersetzer-Nachlass haben. Aber welches Archiv hat sich um diese Nachlässe gekümmert – oder wird es in Zukunft tun?
Welche Übersetzer und Übersetzerinnen sollten im UeLEX im Lauf der nächsten Jahre in umfangreicheren Beiträgen vorgestellt werden? Die VdÜ-Zeitschrift enthält dafür reichlich Hinweise. Das Archiv lässt zusätzlich deutlich werden, dass in der Welt des Übersetzens nicht 5 nur die Übersetzer eine Rolle spielen. Man lese nur in Heft 1/2020 den von Renate Birkenhauer und Helga Pfetsch verfassten Nachruf auf Ursula Brackmann. Brackmann hat wohl nie übersetzt, aber sie hat durch fünf Jahrzehnte für die Interessen der Literaturübersetzer robust gestritten. Auch das muss als Form translatorischen Handelns in einer Kulturgeschichte des Übersetzens im 20. Jahrhundert festgehalten werden.
Und müsste dort nicht sogar unsere heutige Gastgeberin von der Heidelberger Stadtbücherei erwähnt werden, Beate Frauenschuh, der 2011 die „Übersetzerbarke“ des VdÜ verliehen wurde für das von ihr durch Jahrzehnte kuratierte Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm, das sehr stark auch das Literaturübersetzen berücksichtigt hat? (Vgl. Jg. 46, H.1 / 2011).
„Translatorisches Handeln“: Wer danach sucht, richtet sein Interesse nicht mehr nur auf die Frage, was zwei Texte in zwei Sprachen an Gemeinsamkeiten aufweisen müssen, damit der eine als Übersetzung des anderen betrachtet werden kann. Es geht dann auch um die Kontakte zu Verlagen, Lektoren und Kritikern, um die Aktivitäten des Deutschen Übersetzerfonds, um Netzwerke, Honorare, Stipendien und Literaturpreise, um die Mitgestaltung des Diskurses über das Übersetzen. In den Blick kommen ferner Orte des translatorischen Handelns. Das ist nicht nur der Schreibtisch im eigenen Arbeitszimmer, das sind auch die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, das Europäische Übersetzerkollegium in Straelen, das LCB am Berliner Wannsee, die von Helmut M. Braem begründeten Esslinger Gespräche und deren Nachfolgetreffen in Wolfenbüttel. Zu all dem lässt sich im Heft-Archiv hervorragend recherchieren.
Das Interesse der Germersheimer historischen Übersetzerforschung gilt primär einzelnen Übersetzern und ihrem jeweiligen translatorischen Œuvre und Handeln. Aber beim Stöbern im Heft-Archiv kam ich auf den Gedanken, dass man es auch einmal mit einer Kollektivbiographie versuchen könnte. In der müssten Informationen besonders zu jenen Übersetzern zusammengetragen werden, die sich dem Übersetzen als Hauptbeschäftigung verschrieben haben.
Welches Narrativ würde sich für eine solche Kollektivbiographie anbieten? Soll man eine Heldengeschichte erzählen über jene, die uns dank ihrer Übersetzungen Zugänge verschafft haben zu den zahlreichen Literaturen der Welt? Die im Bergwerk der Sprache das Deutsche immer wieder bereichert haben um neue Ausdrucksmöglichkeiten? Oder wäre eine Geschichte des Scheiterns zu schreiben? Die Geschichte eines aus literaturbesessenen Einzelgängern bestehenden Kollektivs, das ab den 60er Jahren in Westdeutschland den Versuch unternimmt, aus dem Literaturübersetzen eine Profession zu machen, einen Beruf, von dem man halbwegs anständig leben könnte und der einem auch noch eine halbwegs anständige Rente bescheren würde. Warum scheint es nach wie vor fast aussichtslos zu sein, vom ambitionierten Übersetzen anspruchsvollster Texte anständig leben zu können? Was ist da schief gelaufen?
Wobei die VdÜ-Zeitschrift freilich auch erkennen lässt, was die Übersetzerzunft selbst an Initiativen entwickelt hat, um nicht nur bei Verlagen für materielle Verbesserungen zu streiten, sondern um auch an öffentliche Mittel für die Übersetzerförderung heranzukommen. Auskunft darüber geben u.a. die Berichte aus den Jahren 2007 und 2018, in denen es um die Jubiläumsfeste zum zehn- bzw. zwanzigjährigen Bestehen des zunächst von Rosemarie Tietze geleiteten Deutschen Übersetzerfonds geht. Dieser DÜF hat bei Bund und Ländern sowie Stiftungen das Geld für eine Vielzahl an Arbeitsstipendien, an Reise-, Weiterbildungsund Mentorenstipendien eingeworben und trägt zudem zu verbesserten „Visibility“ des 6 Übersetzens bei, etwa durch die vom DÜF initiierte Dauer-Gastprofessur für Poetik des Übersetzens an der Freien Universität Berlin.
Für das eben beginnende Wintersemester 2021/22 konnte der DÜF Dank der Corona-Hilfsgelder auf einen Schlag 46 Übersetzerinnen und Übersetzer auf Gastdozenturen an philologisch ausgerichteten Instituten von 39 Universitäten vermitteln: von Greifswald bis Regensburg und München, von Frankfurt an der Oder über Hildesheim und Osnabrück bis nach Saarbrücken. Dem Wissen um das Tun der Übersetzer wird solch Ansturm auf unsere Universitäten hoffentlich einen gehörigen Schub verleihen. Warten wir’s ab. Dass sogar das Germersheimer Übersetzerlexikon und auch unsere heutige Veranstaltung von dem Berliner Corona-Geldsegen profitieren, sei dankbar vermerkt.
Ein letzter Aspekt: Bei meinen ersten Heftarchiv-Recherchen zu der Gruppe von professionellen freiberuflich-hauptberuflichen Literaturübersetzern stieß ich auch auf Berichte von Leuten, die vor 1989/90 in der DDR vom Übersetzen leben konnten. Sie wurden nach der Wende auf die Achterbahn der freien Marktwirtschaft geschleudert. Manche haben sich dort behaupten können und sind beim Literaturübersetzen geblieben. Sie haben sich im VdÜ engagiert und dann auch an dessen Zeitschrift mitgewirkt, Christa Schuenke etwa oder Andreas Tretner.
Gerade beim leidigen Ost-West-Thema hatte ich beim Stöbern im Archiv den Eindruck, dass in der nunmehr gesamtdeutschen Übersetzerzunft ein Maß an freundschaftlicher Kollegialität existiert, das man auf anderen Feldern unseres konkurrenzgetriebenen Kulturbetriebs so ausgeprägt nicht findet. Aber vielleicht ist das bei mir auch nur ein Wunschdenken oder mangelnde Vertrautheit mit der Szene.
Summa: Das Archiv der Zeitschrift namens Der Übersetzer bzw. Übersetzen enthält reichhaltiges Material, aus dem sich Bausteine für die einst zu schreibende Kulturgeschichte des Literaturübersetzens von etwa 1950 bis 2020 gewinnen lassen. Der Dank des Translationshistorikers dafür gilt den mehrere Generationen umfassenden Redakteurinnen und Redakteuren der Zeitschrift und heute insbesondere jenen, die für uns all das Material in einem digital frei zugänglichen und über Register und Suchfunktionen sehr gut erschließbaren Archiv zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte versprechen, dass dieses Archiv eifrig genutzt werden wird.
¹ Helga Pfetsch und Rosemarie Tietze berichteten mir im Anschluss an den Vortrag, dass die Umbenennung der Zeitschrift nicht auf Initiative der neuen Redaktion erfolgt sei, sondern auf einen (auf mehreren Mitgliederversammlungen des VdÜ diskutierten) Antrag eines männlichen Verbandsmitglieds.